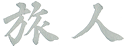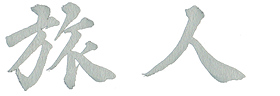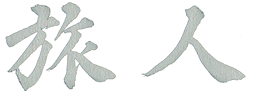Allmählich nähert sich die Reise dem Ende, doch zwei volle Tage habe ich noch. Mit dem Wetter geht es jedoch spürbar bergab – es sind 14 Grad und Regen, und der sieht dieses Mal nicht so aus, als ob er bald aufhören wird. Auch heute habe ich dennoch ein ordentliches Programm vor mir. Zuerst geht es nach Cork, mit rund 225’000 Einwohnern immerhin die zweitgrößte Stadt der Republik Irland und die drittgrößte Stadt der Insel. Wohl auch eine der ältesten Städte, denn sie erhielt schon im 9. Jahrhundert das Stadtrecht. Und wie es in alten Städten nun mal so ist, kann die Parkplatzsuche in der Innenstadt recht abenteuerlich werden, erst recht wenn die halbe Stadt gerade umgebaut wird. Mit etwas Geduld finde ich dann doch ein Parkhaus und mache mich nun im nunmehr strömenden Regen auf in die Gassen der Innenstadt. Die liegt zu einem guten Teil auf einer Flussinsel im River Lee. Bei grauem Himmel und Dauerregen ist es schwer, die Stadt (und die meisten anderen Städte auch, versteht sich) zu mögen, aber der English Market im Zentrum mit all seinen schönen Essständen hat es mir sofort angetan. Dort hing auch ein Banner, auf dem stand »Food capital of Ireland«, und das kann ich mir gut vorstellen. Traditionsgemäß komme ich an der großen Käsetheke nicht so schnell vorbei. Ich bin überrascht, was so alles in Irland an Käse produziert wird, denn in irischen Supermärkten liegen fast nur Cheddarsorten, doch hier gibt es so viel mehr. Ein paar davon werden nun als Souvenir gekauft – da die Tagestemperaturen ja gerade mal bei 16 Grad liegen, sollte das kein Problem sein, zumal man mir den Einkauf auf Anfrage auch einschweißt. Käse ist einer der wenigen Artikel den man noch in Japan einführen darf, und das bis zu 2 Kilo. Wurst-und Fleischprodukte hingegen sind mittlerweile komplett tabu – es gibt sogar Suchhunde, die am Flughafen danach suchen. Aber ich schweife ab.
Ich verlasse Cork noch vor Mittag, in der Hoffnung, dass das Wetter vielleicht ein bisschen besser wird. Wird es aber nicht. Es regnet sogar noch stärker, als ich eine gute Stunde später in Cashel ankomme, einem kleinen Ort mit einer großartigen Burg – dem Rock of Cashel. Die Ruinenanlage beinhaltet unter anderem eine schöne gotische Kathedrale, beziehungsweise dass, was davon übrigblieb, aus dem 12. Jahrhundert. Der Regen passt jetzt aber einigermaßen zur Atmosphäre – es ist grau, nass, teils etwas neblig. Die flechtenbewachsenen, keltischen Kreuze vor diesem tristen Grau machen schon etwas her. Die Anlage ist dabei ziemlich gut besucht, was ich sicher gewusst hätte, wenn ich mich ein bisschen besser vorbereitet hätte. Vor ein paar Tagen erhielt ich nur den Tipp, dass der Rock of Cashel definitiv ein »place of interest« sei. Dabei hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mir nicht allzu viele Burgen anzusehen, denn davon gibt es in Japan viele und in Deutschland auch, und im zarten Alter von 14 bis 18 Jahren habe ich schließlich selbst in einer solchen gewohnt. Die hatte aber noch ein Dach, im Gegensatz zum Rock of Cashel.
Langsam meldet sich mein Magen zu Wort – ich möge doch bitte demnächst etwas essen. Doch vorher muss ich mir noch das »Cashel Folk Village« ansehen, ein Museum der anderen Art. Offensichtlich wurde hier alles von einer Privatperson zusammengetragen, und dies wird nun alles, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Schwiegersohn verwaltet. Die Sammlung ist recht eindrucksvoll, wenn auch der Betreiber ein bisschen zu reißerisch berichtet. Doch ein Ausstellungsstück – es gibt verschiedene kleine Bereiche zu verschiedenen historischen Ereignissen und Dingen aus dem täglichen Leben – interessiert mich ganz besonders: Der Wagen einer »Tinker-»Familie, auch »Irish Traveller« genannt – Nomaden, die in diesen bunten Wagen durch die Lande zogen und dies zum Teil immer noch tun. Der Wagen ist sehr klein und sieht ein bisschen gemütlich aus, aber die Enge muss extrem gewesen sein – es gibt ein kleines Bett für das Paar, die kleinen Kinder schliefen in einer Art Kabinett unter dem Bett – und die älteren Kindern schliefen außerhalb. Je mehr ich über die »Irish Travellers« lese, desto mehr fasziniert mich die Sache, denn viele Sachen scheinen noch immer im Dunkeln zu liegen. Woher kommen sie ursprünglich? Wie kam die Sprache zustande? Und – sind diese Leute glücklich? Alle Engländer, die ich kenne, seien sie auch noch so links engestellt, schimpfen über die »Irish Travellers«, despektierlich manchmal nur »pikeys« genannt, und sagen, dass egal wo sie auftauchen es Probleme gibt. Andererseits gibt es Reportagen über die travellers, in denen selbige sich über Diskriminierung und mangelnden Zugang zu Bildungsangeboten beschweren. In der Republik Irland gibt es wohl auch heute noch um die 30’000 Angehörige, aber die ziehen nicht mehr in diesen runden Wagen umher. Doch der Wagen, der hier ausgestellt wird, wurde noch bis in die 1980er von Irish Travellers benutzt. Faszinierend.
Jetzt ist aber wirklich Zeit, etwas zu essen. Vieles hat zu, aber das Restaurant im Keller des Bailey’s Hotel hat noch offen – und ich bestelle etwas, was ein bisschen nach Fast Food klingt – Cajun chicken mit Käse im Fladenbrot. Aber es schmeckt erstaunlich gut – genau das, was ich bei dem Wetter brauche. Und bevor es im nach wie vor strömenden Regen weitergeht – über Orte mit so seltsam klingenden Namen wie Killenaule oder Cuffesgrange bis nach Kilkenny. Ein bekannter Name, wobei ich jedoch das Bier von hier nicht besonders schätze, aber das ist Geschmackssache. Jemand erklärte mir mal, das sei Condensed Horse P**, aber das geht zu weit.
Auch in Kilkenny steppt der Bär – das Schloss von Kilkenny ist ein Besuchermagnet, und ich kann es durchaus verstehen, denn die Inneneinrichtung ist zu einem guten Teil noch im Originalzustand und sehr sehenswert. Es muss ein bisschen unheimlich gewesen sein, hier zu wohnen – in diesen zahlreichen Gemächern mit den hohen Decken. Demgegenüber also standen die engen Häuschen der Bauern und Diener und Angestellten. Weiter. Kilkenny ist ebenfalls ziemlich touristisch – an einer Häuserwand steht »Experience the famine!« Das geht mir ein bisschen zu weit… nein, eine Hungersnot möchte ich nicht nacherleben. Vielleicht wäre ich da nicht so sensibel, wenn ich nicht wüsste, dass eine ähnlich katastrophale Hungernot in den 1990ern in Nordkorea, immerhin nur 500 Kilometer von Japan entfernt, abspielte, beim sogenannten »ardeous march«. Von Afrika natürlich ganz zu schweigen, doch Hungersnöte gibt es eben leider immer noch, auch in der nördlichen Hemisphäre, und aus dem Grund will ich das nicht selbst erleben, denn wie auch immer die Hungersnot museumstechnisch aufgearbeitet wird – der Begriff »erleben« kommt an das wahre Geschehen ganz sicher nicht heran. Also lasse ich die Angelegenheit links liegen und laufe weiter durch die kleine Stadt, zur Hl. Marien-Kathedrale und dem etwas trostlos ausschauenden Market Cross Shopping Centre.
Und wieder sind zwei weitere Stunden wie im Flug vergangen. Zeit, die letzte Etappe anzutreten, und zwar nach Waterford, ganz im Südosten der Insel. Huch, das ist ja zur Abwechslung mal ein richtig englischer Name. Die Stadt liegt am River Suir und nur wenige Kilometer von der Flußmündung entfernt. Das Hotel ist schnell gefunden – ich übernachte im Treacys Hotel Waterford, direkt an der Rice Bridge. Die heißt nicht etwa so weil es hier Reis gibt, sondern weil es hier mal einen katholischen Missionar mit dem Namen Edmund Ignatius Rice gab.
Das Hotel sieht von außen aus, als ob es um die 20 Zimmer hat. In Wahrheit ist es riesig – man rennt erstmal gute hundert Meter durch verschiedene, plüschbehaftete Korridore, alles ist ein bisschen schwülstig, aber im ansonsten im Großen und Ganzen in Ordnung. Da es schon spät ist, geht es sofort wieder raus, ab in den strömenden Regen. Waterford gilt als älteste Stadt Irlands und ward wohl von Wikingern gegründet. Ein paar massive Befestigungsanlagen wie der Reginald’s Tower, erbaut irgendwann zwischen 13. und 14. Jahrhundert durch Anglo-Normannen. Auch die Saint Patrick’s Catholic Church ist einen Blick wert – die ist mit einer Bauzeit im 18. Jahrhundert relativ jung, aber die älteste postreformatorische katholische Kirche auf der Insel. Leider hat sie schon geschlossen, genauso wie die Kathedrale mit dem imposanten Namen »Cathedral of the Most Holy Trinity Within«. Das Zentrum ist dank des Regens und sicher auch dank der Tatsache, dass es Dienstag ist, wie leergefegt. Und da es dann doch langsam dunkel wird, gehe ich zurück, vorbei an einer Gruppe grölender Jugendlicher, mit denen ich mir nur ungern einen Pub teilen würde. Erst recht, weil sie auf Deutsch rumkrakeelen. Echt jetzt?
Richtig großen Hunger habe ich nicht nach dem späten Mittag in Cashel und einem kleinen Snack in Kilkenny, aber irgendwas soll es dann doch sein. Ich begebe mich in die Grattan Bar gegenüber vom Hotel. Irgendwas auf der Speisekarte scheint von der Größe her genau richtig und war etwas, was ich die ganze Zeit schon in Irland probieren wollte. Doch jemand war schneller – die letzte Portion wurde kurz zuvor verkauft. Okay, Fish & Chips dann. Wenn ich nur vorher nachgeschaut hätte, wüßte ich, dass dieser Pub für seine riesigen Portionen bekannt ist. Der Koch schmunzelt mich an, als er den Riesenteller vor mir abstellt, ich glaube fast, dabei ein leichtes Stöhnen der Erleichterung zu hören. »I hope you are hungry« sagte er noch und verschwand. Vor mir: 3 riesige frittierte Stücken Fisch, darunter beinahe zigarettenschachtelgroße Pommes. Um Gottes Willen. Ich beginne zu essen – und bin mir schnell sicher, dass ich den Fish auf jeden Fall schaffen werde, denn er schmeckt vorzüglich: Sehr frisch und gerade so durchgekocht in der Mitte, mit einer so knusprigen und leckeren Panade. Das erinnert mich stark an das Shamrock, einem Irish Pub in Tokyo, in dem ich ein Jahr lang gearbeitet habe – dort waren die Fish & Chips ähnlich gut. Auch die Pommes sind gut, aber definitiv zu viel. Bei einem oder vielleicht auch zwei Smithwick’s Red Ale im Hotelpub, auf den Fernsehern läuft die Fußball-EM, lasse ich den Abend ausklingen. Dabei komme ich noch mit einem jungen, etwas rough aussehenden Iren ins Gespräch, der mich fragt, ob ich am Vortag auch bei einer gewissen Veranstaltung in Waterford war. Ich verneine das, und sage ihm dass ich heute erst aus Killarney angereist sei. Er ist hocherfreut, denn er kommt von dort. Er meinte, die Fahrt mit dem Zug muss wohl lange gedauert haben, aber ich sage ihm, dass ich mit dem Auto unterwegs bin. »Yeah, droiving is the best way« – er spricht wunderschön alle »i« -Laute als »Oi« aus, aber immerhin kann ich ihm halbwegs folgen.